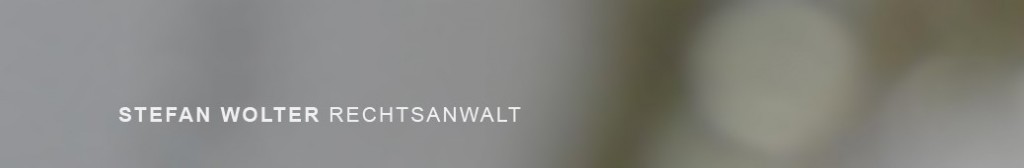Zunächst fragt sich, ob Strom begrifflich und rechtlich als „Produkt“ anzusehen ist, anschließend wann er fehlerhaft ist und schließlich, wer sich als Hersteller behandeln lassen muss.
Der Begriff des Produkts ist gesetzlich in § 2 ProdHaftG definiert, d.h. darunter fallen alle beweglichen Sachen selbst dann, wenn sie Teil einer unbeweglichen Sache sind. Gemäß ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung ist aber auch Elektrizität ein Produkt.
Die bloße Stromunterbrechung kann sicherlich keine Produkthaftung nach sich ziehen. Nicht selten kommt es durch Unregelmäßigkeiten bei der Stromversorgung aber zu echten substanziellen Schäden an Elektrogeräten oder elektrisch betriebenen Steuerungsvorrichtungen und nachfolgend zu weiteren Folgeschäden, etwa bei Ausfall der Heizung in Gestalt von Frostschäden oder umgekehrt bei Ausfall einer Kühlung in Gestalt von verdorbenen Lebensmitteln. Da die Bestimmungen des ProdHaftG bei Sachschäden hingegen nur für Sachen des (gewöhnlich und überwiegend) privaten Ge- oder Verbrauchs gelten, ist grundsätzlich nur der private Konsument geschützt, nicht dagegen ein Gewerbebetrieb.
In einer Entscheidung vom 25.02.2014 (= BGH VersR 2014, 593) hatte der BGH nun höchstrichterlich zu klären, ob das Produkt Strom im Falle einer Überspannung (nach einem vorangegangenen Stromausfall) als fehlerhaft angesehen werden muss, wenn die Ursache der Überspannung in der Unterbrechung zweier Schutzleiter außerhalb des Hauses lag. Zu klären war außerdem wer in einer solchen Situation als Hersteller des Stroms für die entstandenen substanziellen Schäden an Elektrogeräten einzustehen hat.
Wie der BGH klarstellte, orientiert sich die objektiv berechtigte Sicherheitserwartung an ein Produkt unter anderem an gesetzlichen Sicherheitsvorschriften oder technischen Normen, wobei die Einhaltung solcher Sicherheitsstandards durch ein Produkt aber noch nicht bedeuten müsse, dass es fehlerfrei wäre. Die berechtigte Sicherheitserwartung für Strom ergebe sich jedenfalls in technischer Hinsicht aus der Niederspannungsanschlussverordnung NAV, denn § 16 Abs. 3 NAV verpflichte den Netzbetreiber, Spannung und Frequenz möglichst gleichbleibend zu halten, so dass allgemein übliche Verbrauchsgeräte und Stromerzeugungsanlagen einwandfrei betrieben werden können. Zumindest bei übermäßigen Spannungsschwankungen sei diese Sicherheitserwartung aus § 16 Abs. 3 NAV enttäuscht und der Strom damit fehlerhaft.
Doch wer ist nun der verantwortliche Hersteller? Bei der eigentlichen Erzeugung von Strom, unter Umständen weit entfernt in einem Kraftwerk oder einer Windkraftanlage, liegt zwar gewiss eine Herstellung vor, dennoch wird der Strom regelmäßig nicht einfach an die Endverbraucher weitergeleitet, er wird vielmehr notwendigerweise durch Transformation auf eine andere Spannungsebene gebracht, d.h. auf die so genannte Niederspannung. Erst Strom auf der Ebene der Niederspannung ist in Haushalten dann auch nutzbar. Der BGH entschied daher, dass bei der Transformation die Eigenschaft der Elektrizität verändert werde und dass darin der Herstellungsprozess für das Endprodukt Niederspannung liege. Wenn der Stromnetzbetreiber die Transformation vornehme, dann sei er nicht nur bloßer Lieferant, sondern auch Hersteller.
Der verklagte Netzbetreiber hatte aber nicht nur seine Herstellereigenschaft bestritten, er hatte auch eine Entlastung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 ProdHaftG angestrebt und geltend gemacht, das Produkt Elektrizität sei beim Inverkehrbringen noch fehlerfrei gewesen, denn nach der Transformation und beim Einspeisen in das Niederspannungsnetz habe es noch keinerlei unzulässige Spannungs- und Frequenzschwankungen gegeben. Auch diesem Verteidigungsversuch erteilte der BGH eine Absage und entschied, die Herstellersphäre ende nicht durch die Einspeisung des Stroms in das Niederspannungsnetz, sondern erst beim Endkunden an dessen Netzanschluss, weil die Anlage des Netzbetreibers gemäß § 5 NAV i.V.m. § 8 NAV bis zur Hausanschlusssicherung reiche. An diesem Übergabepunkt sei der Strom aber nicht fehlerfrei zur Verfügung gestellt worden.
Schließlich stellte der BGH abschließend noch fest, dass eine Haftung des Netzbetreibers aus § 18 NAV wegen eines widerleglichen Verschuldens und mit bestimmten Haftungshöchstbeträgen einer Haftung aus §§ 1 ff. ProdHaftG nicht entgegen stehe. Dazu ist an dieser Stelle nur soviel anzumerken, dass die Bestimmungen des NAV nur das Rechtsverhältnis zwischen Netzanschlussnehmer und Netzbetreiber regeln. Es geht in der täglichen Praxis aber auch um Schäden bei Personen, die nicht Netzanschlussnehmer sind. Für diese Geschädigten dürfte eine Haftung des Netzbetreibers aus Produkthaftung also eine recht große Rolle spielen.
Zu bedenken ist außerdem, dass häufig Stromlieferungsverträge mit Anbietern geschlossen werden, die selbst gar keine Stromnetze unterhalten und daher keine Netzbetreiber sind, so dass diese bloßen Stromlieferanten weder nach der NAV, noch nach den §§ 1 ff. ProdHaftG, sondern eigentlich nur aus Vertrag haften müssten. Dennoch steht auch den Kunden bloßer Stromlieferanten von Fall zu Fall auch eine Inanspruchnahme eines anderen Beteiligten, nämlich des Netzbetreibers aus § 18 NAV oder aus Produkthaftung zur Disposition.