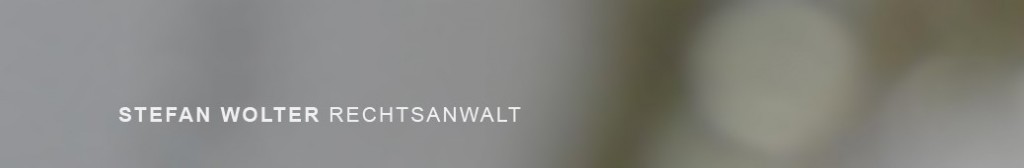Wird durch die Wirkungen von Flüssigkeiten, die von einer Rohrleitungsanlage ausgehen, ein Personen- oder Sachschaden verursacht, so hat gemäß § 2 I 1 HPflG der Inhaber dieser Rohrleitungsanlage aus Gefährdungshaftung, d.h. ohne das Erfordernis eines Verschuldens, auf Schadensersatz einzustehen.
Inhaber einer Anlage im Sinne des § 2 I 1 HPflG ist, wer die tatsächliche und rechtliche Einwirkungsmöglichkeit auf die Gefahrenquelle hat. Maßgeblich ist dabei nicht etwa das Eigentum an der Anlage sondern die Einwirkungsmöglichkeit auf die Durchleitung in technischer Hinsicht (vgl. BGH NJW 1989, 104 sowie OLG Düsseldorf VersR 1999, 967) sowie die Frage, wer die rechtliche Befugnis hat, über die Errichtung, Unterhaltung, Änderung und Erneuerung der Rohrleitung zu entscheiden(vgl. BGH VersR 2008, 825). Wer die Kosten von Errichtung, Unterhaltung, Änderung und Erneuerung der Anlage zu tragen hat, spielt für die Inhaberschaft keine Rolle (vgl. erneut BGH VersR 2008, 825).
Die allermeisten kommunalen Trinkwassersatzungen sehen vor, dass der Grundstücks- bzw. Hausanschluss der Trinkwasserleitung von dem Abzweig in der Straße bis zur Hauptabsperrvorrichtung mit Messeinrichtung (=Wasseruhr) vom zuständigen Wasserversorger hergestellt, erneuert, geändert und unterhalten wird, während die Kundenanlage in Fließrichtung des Wassers erst hinter dieser Messeinrichtung beginnt. Demnach ist der zuständige Wasserversorger bis einschließlich der Wasseruhr als Inhaber der Leitung im Sinne des § 2 I HPflG anzusehen und muss grundsätzlich verschuldensunabhängig für einen Schaden durch Bruch oder sonstige Undichtigkeit haften.
Hingegen scheinen bei einigen Kommunen, speziell offenbar in Süddeutschland, besondere Bestimmungen in den Wasserversorgungssatzungen zu existieren, wonach die gesamten Grundstückanschlüsse alleine von den Grundstückseigentümern hergestellt, unterhalten und erneuert werden müssen. Zur Wasserversorgungsanlage des kommunalen Wasserversorgers zählt dann nur derjenige Teil, welcher sich im öffentlichen Straßengrund befindet. In solchen Ausnahmefällen ist daher der kommunale Wasserversorger nicht Inhaber der auf dem Grundstück befindlichen Wasserleitung. Ähnliche Ausnahmen gibt es dann, wenn auf dem Grundstück außerhalb des Gebäudes ein besonderer Schacht für den Hausanschluss existiert, in welchem auch die Messeinrichtung untergebracht ist, d.h. dann endet die Einstandspflicht des Wasserversorgers räumlich in einem solchen Schacht an der Wasseruhr.
Denkbar klar ist, dass die Schadensersatzpflicht aus § 2 I 1 HPflG grundsätzlich jeden Sach- bzw. Substanzschaden an und in einem Gebäude umfasst. Höchst umstritten ist aber, ob sich die Ersatzpflicht „auch“ oder eben notfalls isoliert „nur“ auf die Kosten einer Leckortung, die Erdbewegungsarbeiten und/oder die eigentliche Reparatur an der Rohrleitung erstreckt. Bei derartigen Schadenkosten berufen sich die kommunalen Wasserversorger regelmäßig auf ihre Wasserversorgungssatzungen und die übergeordneten Kommunalabgabengesetze, welche praktisch flächendeckend vorsehen, dass der Anschlussnehmer sämtliche Kosten der Erneuerung, Unterhaltung und Änderung der Rohrleitung zu tragen hat. In der Tat haben die Wasserversorger dabei die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte auf ihrer Seite, denn nach dieser sollen u.a. auch die Kosten einer Rohrreparatur nach einem Schaden unter den Begriff einer Unterhaltungsmaßnahme fallen.
Dies erscheint jedoch deshalb höchst zweifelhaft, da § 2 HPflG gemäß § 7 HPflG eine zwingende Haftungsregelung für Sachschäden zugunsten von Privatleuten darstellt und für Schadenereignisse ja gerade entgegenstehende Kostentragungsregelungen = Schadensersatzpflichten vorsieht. Zudem handelt es sich bei den Bestimmungen des HPflG um ein Bundesgesetz, welches etwaig entgegenstehendes Landesrecht, also etwa Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes oder kommunale Satzungen, gemäß Art. 31 GG „bricht“. Deshalb müsste richtigerweise eigentlich der Kostenaufwand für die Reparatur einer gebrochenen Wasserleitung sowie für die Ortung der Leckstelle und/oder die Erdarbeiten nach § 2 HPflG vom kommunalen Wasserversorger übernommen werden. Solche Kosten dienen der Schadensminderung bzw. Schadensabwehr und sie sind nicht etwa Reflex von normalen „Unterhaltungsmaßnahmen“, die der Anschlussnehmer nach der kommunalen Trinkwasserversorgungssatzung zu tragen hätte (so AG Sinsheim, Urteil vom 12.04.00, AZ 1 C 526/99 und LG Heidelberg, Urteil vom 01.03.01, AZ 7 S 35/90, beide Urteile nicht veröffentlicht). Hinzu kommt, dass weder für eine Sachbeschädigung nach § 303 StGB, noch für eine Eigentumsverletzung nach § 823 I BGB eine echte Substanzschädigung erforderlich ist, es genügt vielmehr eine wesentliche Beeinträchtigung der Sache (vgl. BGH NJW-RR 1990, 1172 und BGH NJW 2004, 356).
Der BGH hat sich von diesen Argumenten und dem Begriff eines Schadens allerdings nicht beeindrucken lassen und eine Haftung des Wasserversorgers aus § 2 HPflG für die Erdarbeiten zum Auffinden und Beseitigen einer Rohrbruchs an der Trinkwasserleitung abgelehnt. Der BGH führte aus, es komme in solchen Fällen gar nicht zu einem Wertungswiderspruch zwischen zivilrechtlichen Haftungsnormen und öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungsregelungen, denn die öffentlich-rechtlichen Normen seien vielmehr vorrangig und daran habe sich die Auslegung der zivilrechtlichen Haftung zu orientieren (BGH NJW-RR 2007, 823). Gegen diese Rechtsauffassung des BGH hätte man theoretisch mit einer Verfassungsbeschwerde vorgehen können, denn die zivilrechtlichen Regeln und damit auch diejenigen des HPflG gehen als Bundesrecht gemäß Art 31 GG eindeutig den landesrechtlichen Kostenerstattungsregelungen vor und nicht umgekehrt. Außerdem führt die Rechtsprechung des BGH natürlich auch noch dazu, dass sich der kommunale Wasserversorger nicht um Pflege und Kontrolle „seiner“ Anlage sorgen muss, sondern einem Bruch der Trinkwasserleitung und sogar einer Versorgungsunterbrechung zumindest dann seelenruhig entgegen sehen kann, solange es zu keinen echten Substanzschäden am und im Gebäude kommt.
Die Schadensersatzpflicht des Inhabers der Anlage für echte Substanzschäden ist wiederum unbestreitbar und anderweitig aber räumlich nach § 2 III Nr. 1 HPflG begrenzt. Eine Ersatzpflicht scheidet nach dieser Bestimmung dann aus, wenn der Schaden innerhalb eines Gebäudes entstanden und auf eine darin befindliche Anlage zurückzuführen ist. Gemeint ist damit der Bruch oder die Undichtigkeit der Trinkwasserleitung im Bereich ab der Gebäudeaußenwand bis zur Wasseruhr innerhalb des Gebäudes (klargestellt in BGH NJW 2014, 3577 sowie nochmals in BGH VersR 2015, 374). Die Haftung des kommunalen Wasserversorgers für Rohrbrüche an seiner Anlage endet also, wenn man so will, bereits an der Außenwand des Gebäudes des Anschlussnehmers. Ohne Bedeutung ist es hingegen regelmäßig, wenn der Rohrbruch innerhalb eines befriedeten Grundstücks entstanden ist, denn die Ersatzpflicht scheidet nur dann aus, wenn dieses Grundstück im Besitz des Inhabers, also des kommunalen Wasserversorgers stehen würde. Für den Rohrbruch auf einem befriedeten Grundstück, welches im Besitz (und Eigentum) des Anschlussnehmers steht, gibt es also keine grundlegenden Haftungshindernisse.
Gelegentlich sind Trinkwasserleitungen aber auch unterhalb eines Gebäudes, d.h. unterhalb der Bodenplatte verlegt, wo sie ebenfalls aus den verschiedensten Gründen eines Tages undicht werden bzw. brechen können. Dann kann sich wiederum die Frage stellen, ob dieser Bereich als innerhalb oder als außerhalb des Gebäudes zu verstehen wäre. Ein Schaden tritt indes nach natürlichem Sprachgebrauch nur dann innerhalb eines Gebäudes ein, wenn dies in dem durch die Bodenplatte, die Wände und das Dach umschlossenen Raumgebilde geschieht. Für eine erweiternde Auslegung von § 2 III Nr. 1 HPflG über den eigentlichen Wortlaut hinaus gibt weder die Entstehungsgeschichte, noch der Gesetzeszweck dieser Norm eine Handhabe, so dass bei einem Rohrbruch der Trinkwasserleitung unterhalb der Bodenplatte der Anlageninhaber einzustehen hat (so auch OLG Braunschweig Urteil vom 09.09.1983 Az. 2 U 79/83, OLG Stuttgart Urteil vom 11.099.2002 Az. 4 U 69/02 sowie LG Marburg Urteil vom 30.05.2012 Az. 1 O 250/11, alle Urteile nicht veröffentlicht).
Gemäß § 2 III Nr. 3 HPflG ausgeschlossen ist jegliche Haftung des Anlageninhabers jedoch dann, wenn der Schaden durch höhere Gewalt verursacht worden ist. Als Fälle höherer Gewalt hätten hier Naturkatastrophen oder unvorhersehbare Eingriffe Dritter, zumal vorsätzliche, zu gelten.