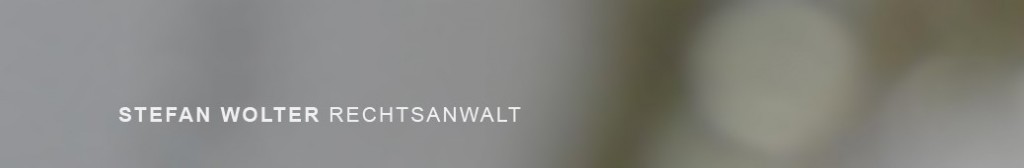Meist denkt man bei der verschuldensunabhängigen Haftung für den Halter oder Fahrer eines KFZ an Verkehrsunfälle im klassischen Sinn, also Schadenereignisse während der KFZ-Benutzung im Straßenverkehr. Dem Wortlaut von § 7 StVG nach kommt es für die Haftung ja auch auf den „Betrieb“ des KFZ an. Was gilt aber z.B. beim Be- und Entladen oder gar bei bzw. nach dem Abstellen eines KFZ?
Nach der älteren Rechtsprechung des BGH (so genannte verkehrstechnische Auffassung) gilt ein KFZ solange als „ in Betrieb“, wie es sich im Verkehr befindet und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet (vgl. BGH NJW 1959, 627). Bei Unfällen auf einem Privatgelände sollte es hingegen nach früherer Rechtsprechung darauf ankommen, ob sich das Kraftfahrzeug maschinentechnisch noch in Betrieb befunden hat (vgl. BGH NJW 1980, 205).
Für eine mögliche Halterhaftung musste daher häufig beurteilt werden, was unter dem Betriebsbeginn und dem Betriebsende bei einem KFZ im Einzelfall zu verstehen ist. Eine kurzfristige Fahrtunterbrechung zum Parken oder zum Be- und Entladen beendet den Betrieb sicherlich nicht. Andererseits endet aber nun einmal die maschinentechnische Betriebsgefahr eines KFZ auch nicht sofort in dem Augenblick, in dem es endgültig abgestellt wird. Die spezifischen Gefahren eines KFZ liegen nämlich auch in technischen Störungen, welche auf den vorangehenden Betrieb zurückgehen. So braucht der Motor eine gewisse Zeit, um abzukühlen, was durch nachlaufende Lüfter deutlich wird. Auch sonst liegen vielfältige maschinentechnische Gefahren bei abgestellten KFZ etwa im Bereich der Batterie und der Bordelektrik.
Der BGH hat kürzlich (BGH Urt. v. 21.01.2014 Az. VI ZR 253/13 = VersR 2014, 396) seine Rechtsprechung erneut fortgeführt, wonach der Begriff „bei dem Betrieb“ nach dem Schutzzweck der Norm weit auszulegen sei und eine Halterin in die Haftung genommen, deren KFZ am Nachmittag in einer privaten Tiefgarage abgestellt worden und erst gegen 1:00 Uhr nachts aus sich selbst heraus durch einen technischen Defekt in Brand geraten war, wodurch u.a. ein weiteres KFZ beschädigt wurde. Nach Auffassung des BGH genüge es, wenn das Brandereignis im Rahmen einer wertenden Betrachtung durch das KFZ mitgeprägt worden sei. Für die Zurechnung der Betriebsgefahr sei es erforderlich aber auch ausreichend, dass das Schadenereignis in einem nahen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit einem Betriebsvorgang oder einer Betriebsvorrichtung des KFZ gestanden habe. Ob der Brand z.B. durch einen Kurzschluss unabhängig vom Fahrbetrieb selbst vor, während oder nach der Fahrt eingetreten sei, mache keinen Unterschied. Anders müsse die wertende Betrachtung aber dann ausfallen, wenn ein geparktes Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt worden sei (vgl. BGH VersR 2008, 656).