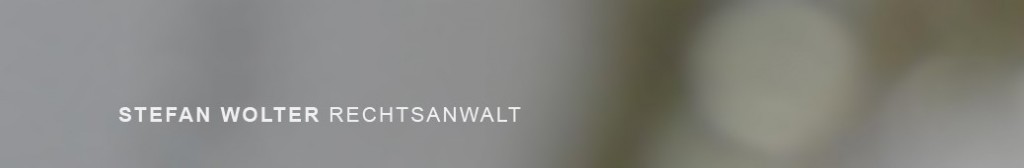Die verschuldensunabhängige nachbarrechtliche Haftung wurde einmal mehr höchstrichterlich ausgedehnt. Im Leitsatz eines am 09.02.2018 verkündeten Urteils des BGH mit dem Az. V ZR 311/16 [*] heißt es:
„Ein Grundstückseigentümer, der einen Handwerker Reparaturarbeiten am Haus vornehmen lässt, ist als Störer im Sinne des § 1004 Abs. 1 BGB verantwortlich, wenn das Haus infolge der Arbeiten in Brand gerät und das Nachbargrundstück beschädigt wird. Dass der Handwerker sorgfältig ausgesucht wurde, ändert daran nichts.“
Im Jahr 1999 hatte der BGH entschieden, der (selbstnutzende) Eigentümer eines Wohngebäudes müsse für einen im einzelnen unaufgeklärten Brandausbruch an der Elektroverteilung im Rahmen einer wertenden Betrachtung für die erlittenen Beeinträchtigungen seines Nachbarn einstehen, denn für die Wartung und Unterhaltung der Elektroanlage sei der (selbstnutzende) Eigentümer grundsätzlich verantwortlich (vgl. BGH VersR 1999, 1139). Später machte der BGH deutlich, die für einen Ausgleichsanspruch erforderliche Störereigenschaft des Nachbarn könne nicht begrifflich verstanden werden, sondern müsse von Fall zu Fall in wertender Betrachtung überprüft werden. Sie müsse dann bejaht werden, wenn es eine allgemeine Pflicht zur Verhinderung möglicher Beeinträchtigungen auch ohne konkreten Anlass gegeben habe (vgl. BGH NJW-RR 2011, 739).
Nun hatte sich der BGH mit nachbarrechtlichen Ausgleichsansprüchen nach einem größeren Brand in der historischen Altstadt von Quedlinburg zu befassen. Am Flachdach eines Hauses hatten die Eigentümer Reparaturarbeiten beauftragt. Im Verlauf der mit einem Brenner durchgeführten Heißklebearbeiten verursachte der Dachdecker die Entstehung eines Glutnestes unter den aufgeschweißten Bahnen. Durch den nachfolgenden zeitlich versetzt entstandenen Brand und die Löscharbeiten wurde anschließend auch das unmittelbar angebaute Haus einer Nachbarin erheblich beschädigt.
Der BGH bejahte in seinem Urteil vom 09.02.2018 einen Anspruch der geschädigten Nachbarin analog § 906 Abs. 2 S. 2 BGB und auch die erforderliche Störereigenschaft. Erforderlich sei dafür, dass die Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks wenigstens mittelbar auf den Willen des Eigentümers oder Besitzers zurückgehe, was in wertender Betrachtung von Fall zu Fall festgestellt werden müsse. Mit der Sicherungspflicht eines Eigentümers sei keine Sorgfaltspflicht im schuldrechtlichen Sinne gemeint, die, um einen nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch zu begründen, von dem Grundstückseigentümer oder -besitzer verletzt worden sein müsse. Entscheidend sei vielmehr, ob der Grundstückseigentümer oder -besitzer nach wertender Betrachtung für den gefahrenträchtigen Zustand seines Grundstücks verantwortlich sei, er also zurechenbar den störenden Zustand herbeigeführt habe.
Der Störereigenschaft stehe nicht entgegen, dass der Brand auf die Handlung eines Dritten, nämlich auf die Arbeiten eine beauftragten Werkunternehmers zurückzuführen sei. Als mittelbarer Handlungsstörer gelte auch derjenige, der die Beeinträchtigung des Nachbarn durch einen anderen in adäquater Weise durch seine Willensbetätigung verursacht habe. Für die Zurechnung des durch den Handwerker herbeigeführten gefahrträchtigen Zustands des Grundstücks komme es ferner nicht darauf an, ob bei der Auswahl des Handwerkers Sorgfaltspflichten verletzt worden seien. Maßgeblich sei vielmehr, ob es Sachgründe gebe, die aufgetretene Störung dem Verantwortungsbereich des Auftraggebers zuzurechnen. Das sei aber der Fall, weil der Auftraggeber derjenige gewesen sei, der die Vornahme von Dacharbeiten veranlasst habe und aus den beauftragten Arbeiten Nutzen habe ziehen wollen. Dass eine sorgfältige Auswahl des Handwerkers erfolgt und ihm die konkrete Ausführungsart nicht vorgeschrieben worden sei, ändere nichts daran, dass mit der Beauftragung von Dacharbeiten eine Gefahrenquelle geschaffen wurde. Der bei der Auftragsausführung verursachte Brand beruhe daher auf Umständen, die dem Einflussbereich des Auftraggebers zuzurechnen seien.
Ferner machte der BGH deutlich, dass die nachbarrechtliche Haftung für beauftragte Handwerker nicht mit der Situation einer Vermietung vergleichbar sei. Anders als ein Mieter, für dessen Störungshandlungen der Eigentümer nur eingeschränkt verantwortlich gemacht werden könne (vgl. die Entscheidung BGH NJW 2006, 992), sei der Handwerker nicht Nutzer des Grundstücks, da er nicht dessen Nutzungsart bestimme, sondern nach den Weisungen des Grundstückseigentümers lediglich bestimmte Tätigkeiten vornehme.
Schließlich stellte der BGH noch klar, dass der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch analog § 906 Abs. 2 S. 2 BGB nicht daran scheitere, dass auch der Handwerker aus unerlaubter Handlung hafte. Die Subsidiarität der nachbarrechtlichen Haftung gelte nur, falls anderweitig eine in sich geschlossene (gesetzliche) Haftungsregelung bestehe. Dies sei aber nicht der Fall. Das Bestehen einer (nachbarrechtlichen) Gesetzeslücke könne nicht damit verneint werden, dass auch ein anderer Haftungstatbestand gegen einen Dritten eingreife.
[*] Das Urteil ist zwischenzeitlich veröffentlicht in NJW 2018, 1542.