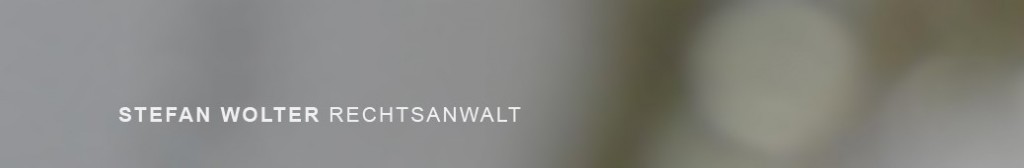Nach einem Verkehrsunfall hat der Geschädigte gemäß § 249 II 1 BGB das Recht, den zur Schadenbeseitigung „erforderlichen“ Geldbetrag ersetzt zu verlangen. Grundsätzlich wird dem Geschädigten dabei zugebilligt, zur Begutachtung und Feststellung der Reparaturkosten am PKW auch einen (eigenen) Sachverständigen einzuschalten und die dadurch ausgelösten Sachverständigenkosten als Teil seines Schadensersatzes vom Unfallgegner gemäß § 249 II 1 BGB einzufordern (ständige Rechtsprechung, vgl. BGH VersR 1985, 1092 sowie etwa BGH VersR 2013, 1590). Insbesondere ist es wegen § 249 II 2 BGB auch zulässig, die Netto-Reparaturkosten fiktiv bzw. abstrakt anhand eines Sachverständigengutachtens geltend zu machen, d.h. es ist nicht notwendig, eine Reparaturkostenrechnung vorzulegen. Als „erforderlich“ im Sinne von § 249 II 1 BGB einzustufen sind regelmäßig solche Aufwendungen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der gleichen Lage tätigen würde (vgl. BGH NJW 1985, 2639 sowie BGH VersR 2013, 1544). Auf Gutachtenkosten übertragen bedeutet dies aber, dass bei Bagatellschäden ein Sachverständigengutachten nicht unbedingt „erforderlich“ ist. Die Bagatellgrenze hat der BGH zuletzt bei EUR 700,00 angesiedelt (vgl. BGH NJW 2005, 356), dieser Betrag könnte mittlerweile wegen der allgemeinen Preissteigerung durchaus etwas höher ausfallen.
Ein besonderer Grundsatz im Schadensersatzrecht ist es aber, dass der Geschädigte gemäß § 254 BGB unter dem Gesichtspunkt der Schadenminderung verpflichtet ist, im Rahmen des Zumutbaren die kostengünstigste Art der Schadenbeseitigung zu wählen. Verstößt der Geschädigte schuldhaft gegen dieses Gebot der Schadenminderung, so kann der an sich bestehende Schadensersatzanspruch für z.B. die „erforderlichen“ Reparatur- oder Ersatzbeschaffungskosten einer Sache auf die wirtschaftlichste Variante gekürzt werden. Den schuldhaften Verstoß gegen Schadenminderungspflichten müsste hingegen der Schädiger beweisen.
Die Frage nach der „Erforderlichkeit“ von Schadenkosten wird in der täglichen Praxis meist nicht oder nicht sauber genug von der Frage der nach Schadenminderminderungsplicht getrennt. Daher kann es leicht passieren, dass der gegnerische KFZ-Haftpflichtversicherer nach einem Verkehrsunfall die „Erforderlichkeit“ bestimmter Schadenkosten pauschal bestreitet bzw. Nachweise dafür verlangt und je nachdem Rechnungsbeträge kürzt und nur Teilbeträge erstattet. Ähnlich werden daher bisweilen die Honorare für die Sachverständigengutachten behandelt, d.h. auch dort wird kurzerhand die Erforderlichkeit des Honorarsatzes bestritten und nur ein geringerer Betrag bezahlt.
Genauso war es einem Geschädigten ergangen, der dann den Versuch unternahm, die restlichen Kosten für das Sachverständigengutachten vor dem AG Seligenstadt beim Unfallgegner einzuklagen, dort aber vollständig scheiterte, weil angeblich die Erforderlichkeit der gesamten Gutachtenkosten nicht ausreichend dargelegt und nachgewiesen worden sei. Die Berufung des Geschädigten zum LG Darmstadt war nur teilweise erfolgreich, die Revision zum BGH wurde jedoch ausdrücklich zugelassen. Der BGH hob das Berufungsurteil mit einer Entscheidung vom 11.02.2014 (vgl. NJW 2014, 1947) auf und verwies die Sache an das LG Darmstadt zurück. Dabei stellte der BGH einige wesentliche Grundsätze zur Erforderlichkeit von Schadenkosten und zur Schadenminderungspflicht notwendigerweise nochmals klar.
So bekräftigte der BGH erneut, das Gebot zu einer wirtschaftlich vernünftigen Schadensbeseitigung führe nicht dazu, dass der Geschädigte zu Gunsten des Schädigers sparen oder sich so verhalten müsse, als ob er den Schaden selbst zu tragen hätte. Deshalb müsse bei der Prüfung, ob der Schadenbeseitigungsaufwand in vernünftigen Grenzen geblieben sei, auf die individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten des Geschädigten Rücksicht genommen werden. Bei der Einschaltung eines KFZ-Sachverständigen sei der Geschädigte daher nicht zu einer Marktforschung nach den honorargünstigsten Sachverständigen verpflichtet, er dürfe vielmehr einen ohne Weiteres erreichbaren Sachverständigen auswählen.
Zur Darlegung der „erforderlichen“ Schadenbeseitigungskosten, so stellte der BGH weiter klar, genüge regelmäßig die Vorlage einer Rechnung. Der Rechnungsbetrag bilde bei der gerichtlichen Schadenschätzung gemäß § 287 ZPO bereits ein wesentliches Indiz für den „erforderlichen“ Schadensbetrag gemäß § 249 II 1 BGB, da sich in der Rechnung die besonderen Umstände des Einzelfalles einschließlich der beschränkten Erkenntnismöglichkeiten des Geschädigten niederschlagen würden. Ein Indiz für die Erforderlichkeit liege ferner in der Übereinstimmung zwischen dem vom Geschädigten geforderten Rechnungsbetrag und der ihm zugrundeliegenden Preisvereinbarung, sofern dem Geschädigten nach seinem Wissensstand und seinen Erkenntnismöglichkeiten nicht eine (1.) deutlich erkennbare und (2.) auch erhebliche Überschreitung der üblichen Preise vorgehalten werden könne. Daher genüge ein einfaches Bestreiten der Erforderlichkeit des ausgewiesenen Rechnungsbetrages nicht, um in erheblicher Weise die geltend gemachte Schadenshöhe in Frage zu stellen.
Im konkreten Fall habe das LG Darmstadt als Berufungsgericht zu Unrecht den Schadensersatzanspruch bei den Gutachtenkosten auf einen niedrigeren Betrag gekürzt, der sich aus einer Honorarumfrage eines Sachverständigenverbandes ergeben habe. Das Berufungsgericht habe die Indizwirkung der Honorarrechnung und die individuelle Lage des Geschädigten bei der Beauftragung des Sachverständigen verkannt. Nur wenn der Geschädigte selbst habe erkennen können, dass der von ihm beauftragte Sachverständige im Branchenvergleich deutlich überhöhte Honorarsätze verlangen werde, so könne der Geschädigte darauf verwiesen werden, er habe im Rahmen der Erforderlichkeit des Schadenbetrages gemäß § 249II 1 BGB auch einen preiswerteren Sachverständigen beauftragen können. Solche Umstände seien aber in den Vorinstanzen nicht festgestellt worden.
Der BGH verwies die Sache jedoch an das LG Darmstadt zurück, damit der Unfallgegner dort noch Gelegenheit erhalte, notfalls darzulegen und nachzuweisen, dass der Geschädigte gegen seine Schadenminderungspflicht aus § 254 BGB verstoßen habe. Der BGH macht allerdings nochmals deutlich, dass alleine die Überschreitung der aus der Honorarumfrage folgenden üblichen Gebührensätze noch keinen solchen Verstoß begründen könne.